Die Wortwahl überschlägt sich derzeit mit Begriffen zum Extremismus. Vor allem in Deutschland und Österreich überbieten sich derzeit die Medien in der Wahl markiger Begriffe dazu, weil die bisherigen Begriffe inzwischen zu Worthülsen verkommen sind. Also muss dem Publikum mit neuen Sprachmitteln die potenzielle Gefahr von Extremismus unter die Haut geimpft werden. Von rechtskonservativ, rechtsnational, rechtspopulistisch über rechtsextrem bis zu rechtsextremistisch reicht der Wortschatz auf der rechten Seite des Politspektrums. Beim Linksextremismus sind die Medien weniger wortschöpferisch, obwohl auch am linken Politpol ähnliche Vorstellungen über den absolut notwendigen gesellschaftlichen Wandel vorhanden sind. Dass die beiden Pole und deren Parteien sowie Parteivertreterinnen und -vertreter nicht kompatibel sind, kann nicht geleugnet werden. Beide Seiten stehen sich kompromisslos gegenüber und bekämpfen sich seit Jahr und Tag. Nur ist dies im Rahmen einer funktionierenden Demokratie möglich, solange bestimmte Grenzen respektiert werden. Dazu gehören eine klare Absage an Gewalt und Terror gegenüber den Andersdenkenden. Ansonsten sollten die demokratischen Institutionen beiden Seiten des Spektrums offenstehen, also auch eine Regierungsbeteiligung. Diese Diskussion wird zurzeit vor allem zu AfD in Deutschland und zur FPÖ in Österreich geführt. Der Volkswillen hat in den kürzlichen demokratischen Wahlen das rechte Lager gestärkt. Wenn dies ignoriert wird, laufen wir Gefahr, diesen Trend ohne es zu wollen zu unterstützen. Wie also mit dem Phänomen Extremismus umgehen?
Erstens muss ein sachlicher Blick auf die unterschiedlichen Formen von Extremismus möglich sein und nicht gleich jede Forderung von links oder rechts als extrem oder extremistisch abgetan werden. Hier sind die Medien gefordert, die sich leider oft als Vertreter der einen oder anderen Seite verstehen. Eine objektive Berichterstattung lässt stets beide bzw. alle Seiten zu Wort kommen. Sie bietet den Exponenten eine Plattform, auf der ihre unterschiedlichen Meinungen und Haltungen publik gemacht und debattiert werden können. Gute Beispiele dafür in der Schweiz sind die “WELTWOCHE” sowie die “ARENA” (SRF1). Ab und zu geht es heftig und deftig zur Sache, aber dies liegt in der Natur der Dinge. Zum Zweiten muss die Mitte – und hier ist nicht bloss die Partei mit demselben Namen gemeint – ihr Profil stärken und nicht nur als Puffer zwischen den Polen fungieren. Eigenständige Ansätze und Vorschläge müssen die Wucht von linken und rechten Forderungen auffangen und konstruktive Lösungen ermöglichen. Wichtig ist, dass linke und rechte Positionen dabei eingebunden werden. Extremistische Haltungen isolieren sich dadurch und werden von selbst implodieren. Drittens ist es unabdingbar, dass die Volksmehrheiten respektiert werden (s. Wahlen in den USA). Wenn der Volkswille nicht respektiert und politisch nicht adäquat umgesetzt wird – egal ob bei Wahlen oder Abstimmungen – geht der Schuss nach hinten los. Gerade diese Tendenz fördert in Europa extremistische Gruppierungen und deren Ideologien.
Im diesem Sinne ist eine Stärkung des Zentrums, der politischen Mitte eine wichtige demokratische Massnahme, um die Polarisierung der Gesellschaft zu mindern und zu verhindern.
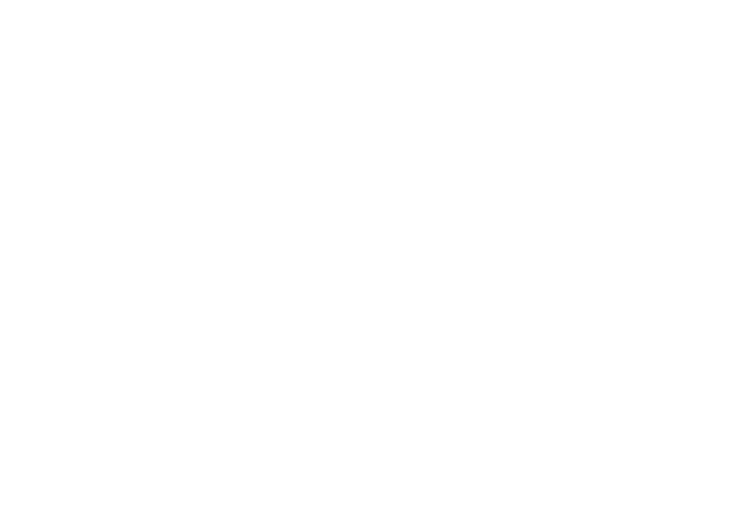

0 Kommentare